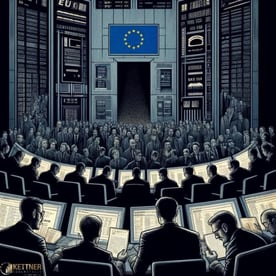
Brüsseler Eiertanz: EU-Gipfel scheitert an belgischem Widerstand gegen russische Vermögen
Die Europäische Union präsentiert sich einmal mehr als zahnloser Tiger. Nach stundenlangen Beratungen beim EU-Gipfel in Brüssel mussten die Staats- und Regierungschefs unverrichteter Dinge auseinandergehen. Der große Plan, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine zu nutzen, scheiterte vorerst am Widerstand Belgiens. Eine Entscheidung wurde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben – oder genauer: auf den 18. Dezember.
Belgiens berechtigte Bedenken
Während EU-Ratspräsident António Costa von "Optimismus" faselte und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ein "deutliches politisches Signal" herbeiphantasierte, sprach der belgische Ministerpräsident Bart De Wever Klartext: "Wenn wir Putins Geld nehmen, tragen wir gemeinsam die Verantwortung, falls etwas schiefgeht." Eine erfrischend ehrliche Einschätzung in einem Meer von EU-Phrasendrescherei.
Belgien ist kein unbedeutender Spieler in dieser Partie. Bei der Finanzinstitution Euroclear in Brüssel lagern satte 170 Milliarden Euro russischer Zentralbankgelder. De Wever fordert zu Recht verbindliche Garantien, eine faire Lastenteilung bei möglichen Verlusten und volle Transparenz über alle eingefrorenen Vermögen in der EU. Man könnte fast meinen, hier agiere jemand mit gesundem Menschenverstand – eine Seltenheit in Brüssel.
Deutsche Wirtschaft zittert vor Milliardenverlust
Besonders pikant: Die deutsche Wirtschaft könnte bei diesem Hasardeurspiel am meisten verlieren. Matthias Schepp von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer warnte eindringlich, dass Deutschland "wie kein anderes Land in Russland investiert" habe. Über 100 Milliarden Euro deutsches Vermögen stünden auf dem Spiel. Doch was kümmert das unseren Bundeskanzler Friedrich Merz? Gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen treibt er das Projekt voran, als gäbe es kein Morgen.
"Deutschland hat wie kein anderes Land in Russland investiert. Es hat deshalb bei der geplanten Nutzbarmachung russischer Zentralbankgelder für Waffenkäufe zugunsten der Ukraine am meisten zu verlieren."
Österreich als Stimme der Vernunft
Unterstützung erhält Belgien immerhin von Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer sprach von "erheblichen rechtlichen Risiken" und forderte ein "rechtlich und wirtschaftlich abgesichertes" Konstrukt. Man fragt sich, warum solche Selbstverständlichkeiten überhaupt erwähnt werden müssen. Sollte nicht jede politische Entscheidung rechtlich abgesichert sein?
Die unbequeme Wahrheit über Europas Dilemma
Die Ukraine benötige nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds für 2026 und 2027 etwa 60 Milliarden US-Dollar an Haushaltshilfen plus 80 Milliarden Euro für Waffen und Munition. Präsident Selenskyj drängte beim Gipfel auf eine rasche Einigung: "Wir brauchen das Geld im Jahr 2026 – und es wäre besser, es gleich zu Beginn des Jahres zu haben."
Doch hier offenbart sich das eigentliche Dilemma: Sollte die EU die russischen Gelder nicht anzapfen können, müssten die Mitgliedstaaten selbst einspringen. Angesichts der hohen Schuldenstände in mehreren EU-Ländern – nicht zuletzt in Deutschland mit seinem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur – ein heikles Unterfangen.
Parallelwelt London
Während in Brüssel die Uneinigkeit regiert, treffen sich in London die Vertreter der "Koalition der Willigen". Der britische Premierminister Keir Starmer will zur Verstärkung der militärischen und wirtschaftlichen Unterstützung für Kiew aufrufen. Man könnte fast meinen, der Brexit habe Großbritannien von den lähmenden EU-Entscheidungsprozessen befreit.
Ein Blick in die Zukunft
Was bleibt, ist ein Scherbenhaufen europäischer Unentschlossenheit. Belgien hat völlig recht, wenn es vor den rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken warnt. Die Geschichte lehrt uns, dass übereilte Entscheidungen, besonders wenn es um die Beschlagnahmung ausländischer Vermögenswerte geht, unvorhersehbare Konsequenzen haben können. Russland wird nicht tatenlos zusehen und könnte seinerseits europäische Vermögenswerte konfiszieren oder internationale Gerichte anrufen.
In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation sollten wir uns fragen, ob es klug ist, weitere Milliarden in einen Konflikt zu pumpen, dessen Ende nicht absehbar ist. Vielleicht wäre es an der Zeit, statt immer neuer Waffenlieferungen endlich ernsthafte Friedensverhandlungen zu forcieren. Doch das würde politischen Mut erfordern – eine Mangelware in Brüssel und Berlin.
Für Anleger bedeutet diese Unsicherheit eines: Physische Edelmetalle wie Gold und Silber gewinnen als krisensichere Anlage weiter an Bedeutung. Während Politiker mit Milliarden jonglieren und die Inflation weiter anheizt, bieten Edelmetalle einen bewährten Schutz vor Währungsturbulenzen und politischen Fehlentscheidungen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












