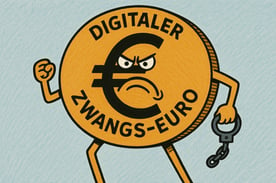BSW-Klausur offenbart tiefe Risse: Wagenknecht rechnet mit eigener Partei ab
Die zweitägige Klausurtagung des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin sollte eigentlich Aufbruchstimmung verbreiten. Stattdessen wurde sie zur Bühne für eine schonungslose Abrechnung der Parteigründerin mit den eigenen Reihen. Besonders brisant: Der kaum verhüllte Angriff auf die thüringische Finanzministerin Katja Wolf, die sich nach Wagenknechts Ansicht von den etablierten Parteien habe "über den Tisch ziehen lassen".
Friedenspartei mit Kriegsstimmung
Die Atmosphäre zwischen Wagenknecht und Wolf sei von "knisternder Spannung" geprägt gewesen, berichten Teilnehmer. Während man nach außen um versöhnliche Eindrücke bemüht war, ließ Wagenknecht in ihrer Rede kein gutes Haar an den Regierungsbeteiligungen in Thüringen und Brandenburg. Diese hätten der "Gesamtpartei geschadet", so ihr vernichtendes Urteil. Man sei nun "eingebunden in das Korsett einer Koalition mit den alten Parteien" und könne nicht liefern.
Besonders pikant: Ausgerechnet die selbsternannte "einzige Friedenspartei Deutschlands" führt offenbar einen internen Krieg gegen die eigenen Landesverbände. Die Ironie dieser Situation dürfte auch den anwesenden Parteifreunden nicht entgangen sein.
Brandmauer-Sprengung als Wahlkampfstrategie?
Für Aufsehen sorgte Wagenknechts überraschender Ratschlag an die CDU in Sachsen-Anhalt: Sie solle doch eine Koalition mit der AfD eingehen. "Die Brandmauer ist eine undemokratische Dummheit, die nur der AfD hilft", polterte die BSW-Chefin. Eine bemerkenswerte Aussage für eine Politikerin, die sich gerne als moralische Instanz inszeniert.
"Wenn es so weitergeht, wird es irgendwann AfD-Alleinregierungen im Osten geben, weil sie gar niemanden mehr für eine Koalition brauchen."
Diese Warnung mag berechtigt sein, doch die implizite Aufforderung zur Zusammenarbeit mit der AfD wirft Fragen auf. Während Wagenknecht betont, ihr BSW sei programmatisch zu unterschiedlich für eine Koalition mit der AfD, attestiert sie gleichzeitig CDU und AfD die "größten Schnittpunkte". Ein durchsichtiges Manöver, um die Christdemokraten in die Bredouille zu bringen?
Mitgliederwerbung als Rettungsanker
Auffällig ist, dass die angeblich prekäre Finanzlage der Partei mit keinem Wort erwähnt wurde. Stattdessen verkündete Generalsekretär Christian Leye vollmundig, man werde "Tausende neue Mitglieder aufnehmen". Bis Ende des Jahres solle die Mitgliederzahl im "fünfstelligen Bereich" liegen. Angesichts der aktuellen Umfragewerte - in Mecklenburg-Vorpommern sechs Prozent, in Sachsen-Anhalt acht Prozent - wirkt dieser Optimismus gewagt.
Die Partei plant dennoch große Schritte: Bis 2027 soll ein detailliertes Parteiprogramm erarbeitet werden, ein Jugendverband gegründet und Regionalstrukturen aufgebaut werden. Spätestens 2029 will man mit einer starken Fraktion in den Bundestag einziehen. Ob diese ambitionierten Ziele mit einer zerstrittenen Führung zu erreichen sind, darf bezweifelt werden.
Wagenknechts ungewisse Zukunft
Besonders vielsagend war Wagenknechts vage Antwort auf die Frage nach ihrer eigenen Zukunft im BSW. Sie werde sich weiter engagieren, "unabhängig von der konkreten Funktion". Ein Parteitag im November soll über eine Namensänderung und einen neuen Vorstand abstimmen. Zieht sich die Namensgeberin etwa zurück?
Das BSW präsentiert sich als "Partei der demokratischen Erneuerung" und "Stimme für wirtschaftliche Vernunft". Doch die Realität zeigt eine Bewegung, die bereits nach wenigen Monaten in den typischen Grabenkämpfen linker Splittergruppen versinkt. Die Geschichte lehrt: Parteien, die nach ihren Gründern benannt sind, überleben selten deren Rückzug. Das Schicksal der Schill-Partei oder der Statt-Partei sollte Warnung genug sein.
Während Deutschland dringend eine vernünftige Alternative zur gescheiterten Ampel-Politik und zur neuen Großen Koalition bräuchte, verliert sich das BSW in internen Machtkämpfen. Die wahren Gewinner dieser Selbstzerfleischung dürften ausgerechnet jene etablierten Parteien sein, gegen die Wagenknecht eigentlich angetreten war.
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik