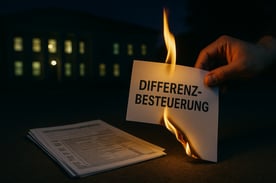Establishment in Panik: Warum die verzweifelten Attacken auf die AfD nach hinten losgehen
Die jüngsten Ereignisse rund um das ARD-Sommerinterview mit Alice Weidel offenbaren die zunehmende Hilflosigkeit des politischen Establishments im Umgang mit der Alternative für Deutschland. Was als medienwirksame Störaktion des sogenannten "Zentrums für Politische Schönheit" gedacht war, entpuppte sich als Eigentor erster Güte – und zeigt exemplarisch, wie die selbsternannten Verteidiger der Demokratie genau das Gegenteil von dem erreichen, was sie beabsichtigen.
Wenn Künstlerkollektive zu nützlichen Idioten werden
Die Aktion am Berliner Spreeufer hätte kaum peinlicher ausfallen können. Mit einem umgebauten Gefangenentransporter und ohrenbetäubender Musik versuchten die Aktivisten, das Interview zu sabotieren. Der renommierte Soziologe Armin Nassehi, der ab Oktober das Amt des Vizepräsidenten der Ludwig-Maximilians-Universität München übernehmen wird, bringt es auf den Punkt: Die Aktion sei "etwas pubertär" gewesen. Doch seine Analyse geht noch weiter – und müsste eigentlich jeden aufrechten Demokraten alarmieren.
Denn was Nassehi feststellt, ist nichts weniger als die komplette Kontraproduktivität solcher Aktionen. Die AfD-Chefin habe inhaltlich wenig zu bieten gehabt, doch genau diese Schwäche sei durch den Protest übertönt worden. "Besser hätte es für Weidel gar nicht laufen können", konstatiert der Soziologe trocken. Ein vernichtenderes Urteil über die Wirksamkeit linker Protestkultur kann es kaum geben.
Die fatale Übernahme der AfD-Diagnose
Nassehis zentrale Erkenntnis sollte in den Redaktionsstuben und Parteizentralen für Aufhorchen sorgen: "Der größte Fehler im Umgang mit der AfD liegt darin, ihre Diagnose zu übernehmen, in diesem Land gehe alles den Bach herunter." Hier trifft der Soziologe einen wunden Punkt. Tatsächlich haben sich weite Teile des politischen Spektrums die Krisenrhetorik zu eigen gemacht – und spielen damit der AfD direkt in die Hände.
Die Realität sieht differenzierter aus: Studien zeigen, dass viele Menschen in Deutschland mit ihrem persönlichen Leben durchaus zufrieden sind. Was jedoch dramatisch schwindet, ist das Vertrauen in die demokratischen Institutionen. Eine Erhebung der Bertelsmann-Stiftung unter jungen Erwachsenen zeichnet ein alarmierendes Bild: Mehr als jeder zweite 18- bis 30-Jährige vertraut der Regierung nicht mehr, 45 Prozent misstrauen dem Parlament.
Merz' Große Koalition enttäuscht auf ganzer Linie
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nach nur 80 Tagen im Amt hat die schwarz-rote Koalition unter Friedrich Merz bereits massiv an Zustimmung verloren. Nur noch 49 Prozent der Deutschen bewerten die Arbeit der Regierung als "eher gut" – ein Absturz von elf Prozentpunkten seit Juni. Besonders bitter für Merz: Die vielgescholtene Ampel-Koalition schnitt nach derselben Zeit im Amt deutlich besser ab.
Diese Entwicklung schlägt sich unmittelbar in den Umfragewerten nieder. Die AfD erreicht mit 24 Prozent ihren besten Wert seit April, während die Union auf magere 27 Prozent abrutscht. Der Abstand zwischen beiden Lagern schmilzt wie Schnee in der Frühlingssonne – ein Alarmsignal, das in Berlin offenbar niemand hören will.
Die gescheiterte Strategie der Ausgrenzung
Die Debatte über den richtigen Umgang mit der AfD wird seit Jahren geführt, doch die Ergebnisse sprechen für sich: 152 AfD-Abgeordnete sitzen im Bundestag, in mehreren Landtagen stellt die Partei die stärkste oder zweitstärkste Fraktion. Die Strategie der totalen Abgrenzung, der berühmten "Brandmauer", hat offensichtlich versagt.
Der Historiker Martin Sabrow warnt vor einer naiven Entzauberungsstrategie durch Einbindung und verweist auf internationale Beispiele: "Wer hätte gedacht, dass Trump nach seiner ersten Amtszeit wiedergewählt werden könnte?" Gleichzeitig plädiert er für "souveräne Gelassenheit" – ein Ansatz, der in der aufgeheizten politischen Atmosphäre kaum noch zu finden ist.
Die emotionale Falle der etablierten Politik
Nassehi identifiziert einen entscheidenden Vorteil der AfD: Sie komme mit wenigen, aber emotional aufgeladenen Argumenten aus. "Sie macht eine emotionalisierte Form von Politik, etwa beim Thema Migration. Und sie lebt davon, Systemkritik zu betreiben." Diese Analyse trifft ins Schwarze – während die etablierten Parteien sich in technokratischen Details verlieren, spricht die AfD die Gefühle der Menschen an.
Die verzweifelten Versuche, die Partei durch Störaktionen, mediale Ächtung oder juristische Manöver zu bekämpfen, erweisen sich als kontraproduktiv. Jede dieser Aktionen liefert der AfD neue Munition für ihre Opferinszenierung und bestätigt das Narrativ vom "Kartell der Altparteien".
Zeit für einen Strategiewechsel
Die Zahlen lügen nicht: Die bisherige Strategie im Umgang mit der AfD ist grandios gescheitert. Statt pubertärer Störaktionen und moralischer Überheblichkeit bräuchte es eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Sorgen und Ängsten der Bürger. Statt die Krisenrhetorik der AfD zu übernehmen, müssten die etablierten Parteien wieder positive Zukunftsvisionen entwickeln.
Doch davon ist wenig zu sehen. Die Große Koalition unter Merz wirkt bereits nach wenigen Monaten müde und ideenlos. Die Opposition verharrt in alten Reflexen. Und die Medien? Die gefallen sich weiterhin in der Rolle der moralischen Instanz, statt kritisch zu hinterfragen, warum ihre Botschaften bei immer mehr Menschen nicht mehr ankommen.
Solange das Establishment nicht begreift, dass Ausgrenzung und Dämonisierung die AfD nur stärker machen, wird sich an dieser Entwicklung nichts ändern. Die Bürger haben längst verstanden, was hier gespielt wird – und wenden sich in Scharen ab. Es ist höchste Zeit für einen grundlegenden Kurswechsel. Doch der ist mit dem aktuellen politischen Personal kaum zu erwarten.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik