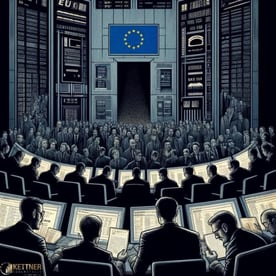EU-Zollpoker mit Trump: Wenn Brüssel wieder einmal einknickt
Der 9. Juli naht mit bedrohlicher Geschwindigkeit. An diesem Tag könnten die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle von bis zu 50 Prozent auf EU-Waren Realität werden – es sei denn, die EU-Bürokraten in Brüssel schaffen es, sich einmal mehr den amerikanischen Forderungen zu beugen. Die Verwirrung über die genauen Zeitpläne, die Trump und sein Handelsminister Howard Lutnick verbreiten, scheint dabei Teil einer bewussten Verhandlungstaktik zu sein.
Das Chaos als Methode
Während Trump zunächst den 9. Juli als Stichtag nannte, sprach sein Minister plötzlich vom 1. August. Diese kalkulierte Ungewissheit versetzt die europäischen Unterhändler in eine Position der Schwäche. Man kennt das Spiel: Der amerikanische Präsident nutzt seine berüchtigte Unberechenbarkeit als Waffe in den Verhandlungen. Und die EU? Sie taumelt wie gewohnt zwischen nationalen Egoismen und bürokratischer Lähmung hin und her.
Die Ausgangslage ist dabei denkbar ungünstig für Europa. Bereits am 2. April hatte Trump EU-Waren mit zehnprozentigen Zöllen belegt, bei Autos sogar 25 Prozent und bei Stahl und Aluminium satte 50 Prozent. Der darauffolgende Börsencrash verhinderte zwar eine weitere Eskalation, doch die Drohung schwebt weiterhin wie ein Damoklesschwert über der europäischen Exportwirtschaft.
Merkels Erbe: Eine gespaltene EU
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die ihre Position bekanntlich mehr politischen Kungeleien als tatsächlicher Kompetenz verdankt, gibt sich gewohnt hilflos. Ein umfassendes Handelsabkommen innerhalb von 90 Tagen sei "unmöglich", tönt sie. Stattdessen hofft sie auf eine "grundsätzliche Einigung" – was auch immer das bedeuten mag. Man könnte meinen, die EU hätte aus den vergangenen Handelskonflikten nichts gelernt.
Besonders pikant ist die Uneinigkeit innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten. Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert zu Recht den "komplizierten" Ansatz der Europäischen Kommission und fordert eine schnelle Einigung zum Schutz der deutschen Schlüsselindustrien. Der französische Präsident Emmanuel Macron hingegen spricht theatralisch von "Erpressung" – als ob die EU selbst nicht ständig mit Regulierungen und Steuern andere Länder unter Druck setzen würde.
Die deutsche Autoindustrie als Faustpfand
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während das Vereinigte Königreich im Jahr 2024 etwa 100.000 Autos in die USA exportierte, verkaufte die EU mehr als 700.000 Fahrzeuge über den Atlantik. Ein Zollabkommen nach britischem Vorbild, das die Einfuhrmenge begrenzt, wäre für die deutsche Automobilindustrie ein Desaster. Doch genau darauf scheint es hinauszulaufen.
"Es geht hier um die schnelle Beilegung eines Zollstreits, insbesondere für die Schlüsselindustrien unseres Landes"
Merz' Worte klingen vernünftig, doch die Realität sieht anders aus. Die EU-Kommission scheint mehr damit beschäftigt zu sein, ihre eigene Haut zu retten, als die Interessen der europäischen Wirtschaft zu vertreten. Jacob Funk Kirkegaard vom Peterson Institute bringt es auf den Punkt: Die Kommission versuche sich vor Angriffen aus den Mitgliedsstaaten zu schützen, anstatt eine klare Verhandlungslinie zu fahren.
Digitale Kapitulation vorprogrammiert?
Besonders besorgniserregend ist die Diskussion um mögliche Zugeständnisse im Bereich der Digitalpolitik. Deutschland erwägt eine zehnprozentige Steuer auf US-Digitalriesen wie Google und Meta. Doch Trump hat bereits klargemacht, dass er solche Pläne nicht tolerieren wird. Kanada hat diese Woche bereits kapituliert und seinen Vorschlag für eine Digitalsteuer fallen gelassen.
Die Ironie dabei: Während die EU ständig von digitaler Souveränität schwadroniert, knickt sie beim ersten Gegenwind aus Washington ein. Anstatt endlich eigene, konkurrenzfähige Tech-Unternehmen aufzubauen, verlässt man sich auf Regulierungen und Steuern – ein Armutszeugnis für die europäische Innovationskraft.
Was ein Scheitern bedeuten würde
Die transatlantischen Handelsbeziehungen erreichten 2023 ein Volumen von 1,6 Billionen Euro. Ein Scheitern der Verhandlungen könnte die EU nach Expertenschätzungen etwa einen halben Prozentpunkt Wachstum kosten. Das mag auf den ersten Blick verkraftbar erscheinen, doch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation wäre es ein weiterer Schlag für die ohnehin angeschlagene europäische Wirtschaft.
Bill Reinsch vom Center for Strategic and International Studies hat vermutlich recht mit seiner zynischen Einschätzung: Trump gehe es vor allem um den Eindruck, "gewonnen" zu haben. Die EU täte gut daran, ihm diesen symbolischen Sieg zu gönnen, um Schlimmeres zu verhindern. Doch selbst das scheint für die zerstrittenen Europäer eine Herausforderung zu sein.
Zeit für einen Kurswechsel
Die aktuelle Krise offenbart einmal mehr die strukturellen Schwächen der EU. Anstatt mit einer Stimme zu sprechen und die eigenen Interessen entschlossen zu vertreten, verliert man sich in internen Grabenkämpfen. Die deutsche Wirtschaft, einst Motor Europas, wird zum Spielball transatlantischer Machtspiele.
Es wäre an der Zeit, dass Europa endlich aufwacht und eine eigenständige, selbstbewusste Handelspolitik betreibt. Doch solange in Brüssel Bürokraten das Sagen haben, die mehr an ihrer eigenen Karriere als am Wohl der europäischen Bürger interessiert sind, wird sich daran wenig ändern. Die Zeche zahlen am Ende die Unternehmen und Arbeitnehmer – während die politische Elite weiter von einer "geeinten" EU träumt, die in der Realität längst nicht mehr existiert.
In dieser unsicheren Zeit bieten physische Edelmetalle wie Gold und Silber eine bewährte Möglichkeit zur Vermögenssicherung. Als krisenfeste Anlage haben sie sich über Jahrhunderte bewährt und sollten in keinem ausgewogenen Portfolio fehlen.
- Themen:
- #Steuern

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik