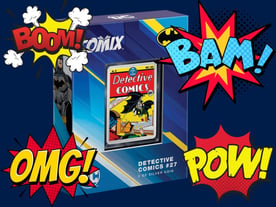
Klingbeils Standortpatriotismus-Forderung: Wenn politisches Versagen auf Durchhalteparolen trifft
Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil hat auf dem Gewerkschaftskongress der IG BCE in Hannover mehr "Standortpatriotismus" von deutschen Unternehmen gefordert. Sie sollten Verantwortung zeigen, Arbeitsplätze sichern und im Land investieren. Doch diese Forderung offenbart die ganze Hilflosigkeit einer Politik, die seit Jahren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen systematisch verschlechtert hat und nun mit patriotischen Appellen die Folgen ihres eigenen Versagens kaschieren möchte.
Die bittere Realität hinter den warmen Worten
Während Klingbeil von Standorttreue schwadroniert, kämpfen deutsche Unternehmen mit einer Realität, die jeglichen Patriotismus zur wirtschaftlichen Selbstaufgabe werden lässt. Die Energiekosten haben sich vervielfacht, die Bürokratie erstickt jede unternehmerische Initiative, und die Steuerlast treibt selbst traditionsreiche Familienunternehmen in die Knie. Wer in diesem Umfeld noch von Standortpatriotismus spricht, der verwechselt offenbar politische Sonntagsreden mit ökonomischer Vernunft.
Die deutsche Industrie steht vor einem Dilemma: Strompreise, die doppelt so hoch liegen wie in den USA, machen jede Produktion zum Verlustgeschäft. Gleichzeitig locken ausländische Standorte mit niedrigen Energiekosten, schlanker Verwaltung und attraktiven Steuermodellen. Da hilft auch kein noch so leidenschaftlicher Appell an die nationale Verbundenheit – Unternehmen müssen wirtschaftlich überleben, bevor sie patriotisch sein können.
Energiewende als Standortkiller
Die vielgepriesene Energiewende hat sich längst als gigantisches Wohlstandsvernichtungsprogramm entpuppt. Während andere Länder auf bezahlbare Energie setzen, treibt Deutschland seine Unternehmen mit ideologisch motivierten Höchstpreisen in die Flucht. Die Folgen sind dramatisch: Ganze Industriezweige wandern ab, Arbeitsplätze verschwinden, und mit ihnen die Grundlage unseres Wohlstands.
"Patriotismus ersetzt keine funktionierende Verwaltung. Wer Standortpatriotismus verlangt, sollte erst die Hürden beseitigen, die Unternehmen täglich behindern."
Diese simple Wahrheit scheint in den Regierungsetagen noch nicht angekommen zu sein. Stattdessen setzt man auf moralische Erpressung: Wer das Land verlässt, sei unpatriotisch. Doch was ist mit der Verantwortung der Politik gegenüber den Unternehmen? Wo bleibt der politische Patriotismus, der sich in vernünftigen Rahmenbedingungen ausdrückt?
Bürokratiewahnsinn statt Standortförderung
Die deutsche Bürokratie hat mittlerweile groteske Ausmaße angenommen. Genehmigungsverfahren ziehen sich über Jahre hin, neue Vorschriften kommen schneller, als Unternehmen sie umsetzen können. Während in anderen Ländern Fabriken in Monaten entstehen, diskutiert man hierzulande noch über die korrekte Formulierung des dritten Umweltgutachtens.
Die Große Koalition unter Friedrich Merz hatte versprochen, die Bürokratie abzubauen. Stattdessen erleben wir eine weitere Verschärfung der Regulierungswut. Das im Koalitionsvertrag verankerte Ziel der Klimaneutralität bis 2045 wird zu einem weiteren bürokratischen Monster, das Unternehmen mit immer neuen Auflagen überzieht.
Die Flucht der Industrie
Besonders dramatisch zeigt sich die Situation in der Chemieindustrie. Einst das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, kämpft die Branche heute ums nackte Überleben. Produktionsstandorte werden geschlossen, Investitionen fließen ins Ausland. Die Gründe sind immer dieselben: zu teuer, zu kompliziert, zu langsam.
Klingbeils Forderung nach mehr Standortpatriotismus wirkt vor diesem Hintergrund wie blanker Hohn. Sollen Unternehmen aus reiner Vaterlandsliebe Verluste in Kauf nehmen? Sollen sie ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Altar des Patriotismus opfern? Diese Erwartung ist nicht nur naiv, sie ist gefährlich.
Das 500-Milliarden-Versprechen: Neue Schulden statt echter Reformen
Die neue Bundesregierung plant ein gigantisches 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur. Doch statt die strukturellen Probleme anzugehen, wird wieder nur Geld verteilt. Diese Politik der Scheinlösungen wird die Inflation weiter anheizen und kommende Generationen mit einer erdrückenden Schuldenlast belasten – trotz Merkels Versprechen, keine neuen Schulden zu machen.
Was Deutschland braucht, sind keine patriotischen Durchhalteparolen, sondern handfeste Reformen: niedrigere Steuern, weniger Bürokratie, bezahlbare Energie. Doch stattdessen erleben wir eine Politik, die ihre eigene Unfähigkeit hinter moralischen Appellen versteckt.
Die wahre Bedeutung von Standortpatriotismus
Echter Standortpatriotismus würde bedeuten, Deutschland wieder zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort zu machen. Er würde sich in einer Politik zeigen, die Unternehmen fördert statt gängelt, die Innovation ermöglicht statt verhindert, die Wachstum schafft statt Stagnation verwaltet.
Stattdessen erleben wir eine Regierung, die ihre eigene Konzeptlosigkeit hinter wohlklingenden Phrasen versteckt. Während Trump in den USA mit massiven Zollerhöhungen amerikanische Interessen durchsetzt – so umstritten diese auch sein mögen –, bettelt die deutsche Politik ihre eigenen Unternehmen an, doch bitte zu bleiben.
Die Realität ist bitter: Deutschland verliert täglich an Wettbewerbsfähigkeit. Die Konkurrenz aus Asien und Nordamerika produziert effizienter, günstiger und mit weniger bürokratischen Hürden. Wer in diesem Umfeld von Standortpatriotismus spricht, ohne die Bedingungen zu verbessern, der betreibt nichts anderes als politische Augenwischerei.
Klingbeils Forderung nach mehr Standortpatriotismus ist symptomatisch für eine Politik, die lieber moralisiert als handelt. Doch Unternehmen brauchen keine patriotischen Appelle, sondern vernünftige Rahmenbedingungen. Solange die Politik diese nicht liefert, wird der Exodus der deutschen Industrie weitergehen – mit oder ohne Standortpatriotismus.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik












