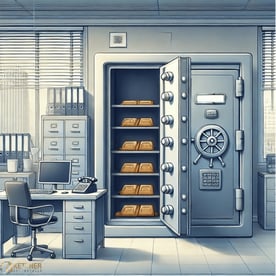Meeresschutz als Feigenblatt: UN-Hochseeabkommen kaschiert das Versagen der Weltgemeinschaft
Während die internationale Staatengemeinschaft sich selbst für ein neues Meeresschutzabkommen feiert, versinken die Weltmeere weiter im Chaos aus Überfischung, Verschmutzung und politischer Untätigkeit. Das UN-Abkommen zum Schutz der Hochsee, das nach der Ratifizierung durch 60 Staaten am 17. Januar 2026 in Kraft treten soll, wird von Umweltorganisationen als "Meilenstein" bejubelt. Doch was steckt wirklich hinter diesem vermeintlichen Durchbruch?
Papier ist geduldig - die Meere sind es nicht
Die Tatsache, dass über 160 Staaten seit März 2023 über zwei Jahre brauchten, um die notwendigen Ratifizierungen zusammenzubekommen, spricht Bände über die tatsächliche Priorität des Meeresschutzes in der internationalen Politik. Deutschland, das sich gerne als Vorreiter in Umweltfragen inszeniert, hat den Vertrag zwar unterschrieben, aber bis heute nicht ratifiziert. Ein neues Gesetz sei dafür nötig, heißt es aus Berlin. Man fragt sich unwillkürlich: Wie viele Gesetze braucht es noch, bis endlich gehandelt wird?
Die Hochsee macht zwei Drittel der weltweiten Ozeanfläche aus und war bisher ein rechtsfreier Raum, in dem industrielle Fischfangflotten ungehindert die Bestände plündern konnten. Dass es erst 2025 gelingt, überhaupt eine rechtliche Grundlage für den Schutz dieser gewaltigen Gebiete zu schaffen, zeigt das komplette Versagen der internationalen Gemeinschaft in den vergangenen Jahrzehnten.
Hehre Ziele, schwache Umsetzung
Das Abkommen soll die Grundlage für großflächige Schutzgebiete auf hoher See schaffen und Umweltverträglichkeitsprüfungen vor Eingriffen in die Meeresumwelt vorschreiben. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Meeresflächen unter Schutz gestellt werden - ein ambitioniertes Ziel, das angesichts der bisherigen Bilanz internationaler Umweltabkommen skeptisch stimmen muss.
Johannes Müller von OceanCare bezeichnet das Abkommen als "Meilenstein" und gleichzeitig als "erst den Anfang". Diese Einschätzung trifft den Nagel auf den Kopf: Nach jahrzehntelanger Untätigkeit ist selbst ein zaghafter Schritt vorwärts ein Fortschritt. Doch reicht das angesichts des katastrophalen Zustands der Weltmeere?
Die wahren Profiteure bleiben unbehelligt
Während Umweltschützer jubeln und Politiker sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, läuft das Geschäft mit der Ausbeutung der Meere munter weiter. Die großen Fischereinationen, allen voran China, haben ihre Flotten in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Ob ein UN-Abkommen diese wirtschaftlichen Interessen tatsächlich eindämmen kann, darf bezweifelt werden.
Die Erfahrung lehrt: Internationale Abkommen sind nur so stark wie der politische Wille zu ihrer Durchsetzung. Und dieser Wille ist traditionell schwach ausgeprägt, wenn es um den Schutz von Gemeingütern wie den Weltmeeren geht. Zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen, zu schwach die Kontrollmechanismen auf hoher See.
Deutschland als Bremser statt Vorreiter
Besonders peinlich ist die Rolle Deutschlands in diesem Prozess. Während die Bundesregierung sich international gerne als Klimaschützerin inszeniert und mit erhobenem Zeigefinger andere Länder belehrt, schafft sie es nicht einmal, ein bereits unterschriebenes Abkommen zeitnah zu ratifizieren. Die Ausrede, man brauche dafür ein neues Gesetz, wirkt angesichts der Dringlichkeit des Themas wie blanker Hohn.
Diese Verzögerungstaktik passt ins Bild einer Politik, die große Ankündigungen liebt, aber bei der konkreten Umsetzung regelmäßig versagt. Während man hierzulande über Gendersternchen und Lastenfahrräder diskutiert, gehen die wirklich drängenden Umweltprobleme im politischen Kleinklein unter.
Ein Tropfen auf den heißen Stein
Das UN-Hochseeabkommen mag ein Schritt in die richtige Richtung sein, doch angesichts der Dimension der Herausforderung wirkt es wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Weltmeere sind überfischt, vermüllt und versauert. Gleichzeitig steigen die Temperaturen, Korallenriffe sterben ab und ganze Ökosysteme kollabieren.
Was es bräuchte, wäre ein radikales Umdenken in der Art, wie wir mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen. Stattdessen bekommen wir ein weiteres internationales Abkommen, dessen Umsetzung Jahre dauern wird und dessen Wirksamkeit höchst fraglich ist. Die Geschichte ist voll von gut gemeinten Umweltabkommen, die am Ende wenig bis nichts bewirkt haben.
Solange die internationale Staatengemeinschaft nicht bereit ist, wirtschaftliche Interessen konsequent dem Schutz unserer Lebensgrundlagen unterzuordnen, werden solche Abkommen Makulatur bleiben. Der wahre Test für das UN-Hochseeabkommen wird nicht seine Ratifizierung sein, sondern seine Durchsetzung gegen die mächtigen Interessen der Fischereiindustrie und der Rohstoffkonzerne. Die bisherige Bilanz internationaler Umweltpolitik lässt wenig Hoffnung aufkommen.
- Themen:
- #Grüne
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik