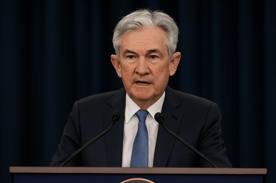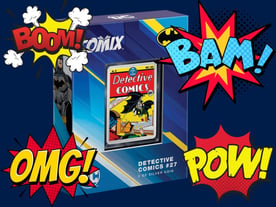Migrationsquote an Schulen: Wenn Bildungspolitik an der Realität scheitert
Die Bundesbildungsministerin hat wieder einmal einen Vorschlag aus der Schublade gezaubert, der die Gemüter erhitzt: Eine Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen. Was auf den ersten Blick nach einer mutigen Lösung für ein drängendes Problem klingt, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als realitätsferner Schnellschuss, der die wahren Herausforderungen unseres maroden Bildungssystems elegant umschifft.
Ein Blick über den Tellerrand – der hinkt
Die Ministerin verweist gerne auf internationale Vorbilder wie Kanada. Ein Land, das mit seinen völlig anderen Strukturen ungefähr so gut als Vergleich taugt wie ein Apfel für eine Birne. Näher läge da schon Dänemark, wo tatsächlich eine Begrenzung auf 30 bis 50 Prozent Schüler mit nicht-westlichem Migrationshintergrund existiert. Doch auch hier zeigt sich: Diese Maßnahme ist nur ein Baustein eines umfassenden migrationspolitischen Gesamtkonzepts – kein isolierter Aktionismus, wie er hierzulande so beliebt ist.
Der entscheidende Unterschied? Dänemark hat einen Migrantenanteil von etwa 15 Prozent. Deutschland hingegen nähert sich der 30-Prozent-Marke. Fast jeder Dritte in unserem Land hat einen Migrationshintergrund. Bei Kindergartenkindern sind es sogar 42 Prozent. Wie soll man diese Masse an Kindern "gerecht" verteilen? Die Antwort ist so simpel wie ernüchternd: Gar nicht.
Die unbequeme Wahrheit über Migration
Bevor die üblichen Reflexe einsetzen: Migration ist in weiten Teilen eine Erfolgsgeschichte. Von den 34,8 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland haben 8,9 Millionen eine ausländische Staatsbürgerschaft. Das sind über 18 Prozent – Menschen, die arbeiten, Steuern zahlen und zum Wohlstand beitragen. Hinzu kommen Millionen mit deutschem Pass und Migrationshintergrund.
Das Problem liegt nicht bei der arbeitenden Bevölkerung, sondern bei der seit 2014 ungelösten Dauerkrise namens Flucht und Asyl. Hier versagt die Politik auf ganzer Linie – doch das ist eine andere Baustelle. Für die Schulquoten-Diskussion spielt es keine Rolle, denn die Kinder sind nun einmal da.
Wenn Ideologie auf Grundgesetz trifft
Eine pauschale Selektion nach Migrationshintergrund würde nicht nur gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen, sondern auch das Elternrecht und das Recht auf Bildung verletzen. Die Klagewelle wäre vorprogrammiert – und das zu Recht. Denn betroffen wären nicht nur schlecht integrierte Neuzuwanderer, sondern auch der Sohn des türkischen Arztes, die Tochter des italienischen Restaurantbesitzers oder das Kind des polnischen Handwerkers – allesamt deutsche Staatsbürger, die sich zu Recht diskriminiert fühlen würden.
Die fragmentierte Gesellschaft – ein Konzept von gestern
Der Vorschlag offenbart ein erschreckendes Unverständnis für die Sozialstrukturen unserer Zeit. Die Vorstellung einer homogenen Gesellschaft, die sich in große Blöcke unterteilen lässt, ist so antiquiert wie die Schreibmaschine. Wir leben in einer fragmentierten Gesellschaft mit unzähligen Parallelwelten – sowohl bei Migranten als auch bei Biodeutschen. Jede Gruppe hat ihre eigenen Werte, ihre eigene Normalität erschaffen.
Die digitale Welt ist dabei der größte Treiber und Weltenerschaffer. Das Internet formt die jungen Menschen mehr als jede Schule es je könnte. Die bittere Wahrheit: Die Schule, einst Protagonist im Formungsprozess, ist heute oft nur noch Statist. Lehrer kennen ihre Schüler kaum noch, wundern sich nur noch über Generationen, die in völlig anderen Realitäten leben.
Sprachdefizite – das eigentliche Problem
In Bayern beherrschen 18,6 Prozent der Kinder vor der Einschulung nicht ausreichend Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Das ist kein Bildungsproblem, sondern ein gesellschaftliches Versagen. Und es betrifft keineswegs nur Migrantenkinder – auch deutsche Kinder aus bildungsfernen Schichten kämpfen mit massiven Defiziten.
Eine Quote kann diese Umfeldprobleme nicht lösen. Sie ist der verzweifelte Versuch, mit einem Pflaster eine klaffende Wunde zu versorgen. Was wir brauchen, ist keine Symptombekämpfung, sondern eine grundlegende Neuausrichtung des Bildungssystems.
Der Weg aus der Bildungsmisere
Statt pauschaler Quoten brauchen wir eine vollumfängliche Erfassung der Lebenswirklichkeiten unserer Schüler: Soziale Milieus, Denkmuster, Befähigungen, Handlungsweisen. Der Migrationshintergrund kann dabei ein Mosaikstein sein – aber nicht der Haupttreiber.
Erst wenn wir verstehen, in welchen Welten unsere Kinder leben, können wir Bildung wieder zu dem machen, was sie sein sollte: Ein Ort der Formung, nicht der bloßen Bestandsaufnahme gesellschaftlicher Zustände. Doch dafür bräuchte es Mut zur echten Reform – nicht nur populistische Scheinlösungen.
Die Migrationsquote ist ein Paradebeispiel für die Hilflosigkeit unserer Bildungspolitik. Sie mag kurzfristig Beifall von den üblichen Verdächtigen ernten. Am Ende stehen aber verlorene Generationen – deutsche wie migrantische. In einer Zeit, in der wir jeden klugen Kopf brauchen, können wir uns solche ideologischen Irrwege nicht leisten. Es ist Zeit für echte Lösungen statt billiger Symbolpolitik.
- Themen:
- #SPD

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik