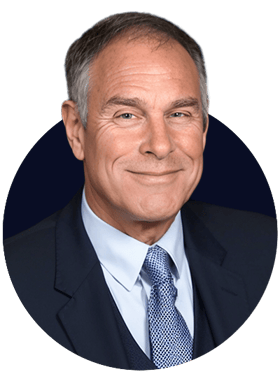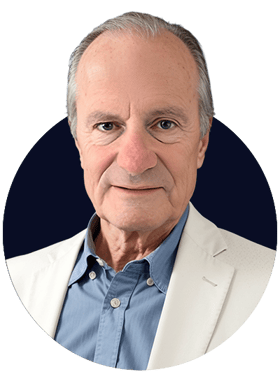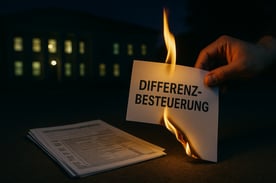NATO-Gipfel ohne Asien: Wenn die treuesten Verbündeten zu Hause bleiben
Während deutsche Medien es geflissentlich verschweigen, spricht die Abwesenheit der asiatischen Staatschefs beim diesjährigen NATO-Gipfel in Den Haag Bände. Die Regierungschefs Japans, Südkoreas und Australiens – einst Stammgäste bei den transatlantischen Zusammenkünften – glänzen durch Abwesenheit. Ein deutliches Signal, das in Berlin offenbar niemand wahrnehmen möchte.
Das Ende der Hofberichterstattung
Was sich hier abzeichnet, ist mehr als nur eine protokollarische Randnotiz. Die asiatischen Partner der USA haben offenbar erkannt, was viele europäische Politiker noch immer nicht wahrhaben wollen: Die NATO-Gipfel sind zu reinen Pflichtveranstaltungen verkommen, bei denen außer Trumps Forderung nach einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf astronomische fünf Prozent des BIP nichts Substanzielles mehr zu erwarten ist.
Der wahre Grund für die frühere Teilnahme der asiatischen Staatschefs war nie die NATO selbst. Es ging schlicht um die Gelegenheit, unter vier Augen mit dem US-Präsidenten zu sprechen. Doch bei einem auf das Minimum verkürzten Gipfel bleibt für solche Gespräche kaum Zeit – und die Reise verliert ihren Sinn.
Südkoreas pragmatische Wende
Besonders aufschlussreich ist der Fall Südkoreas. Der neue Präsident Lee Jae-myung, der sich bereits im Wahlkampf für einen pragmatischeren Kurs aussprach, setzt erste Zeichen. Seine Botschaft ist klar: Seoul wolle "unnötige Feindlichkeit" in den Beziehungen zu Russland und China vermeiden. Ein bemerkenswerter Kurswechsel, der zeigt, dass nicht alle Länder bereit sind, sich bedingungslos in die antirussische und antichinesische Hysterie des Westens einreihen zu lassen.
"Es gibt die Meinung, dass Präsident Lee Jae-myung auf die Befürworter der 'Unabhängigkeit' in der Regierung und der Regierungspartei gehört hat, die sagten, dass die Teilnahme am NATO-Gipfel China und Russland missfallen würde"
Diese Einschätzung der konservativen Zeitung Chosun Ilbo trifft den Nagel auf den Kopf. Während Europa sich immer tiefer in Konflikte verstrickt, die nicht die seinen sind, beginnen andere Länder, ihre nationalen Interessen wieder in den Vordergrund zu stellen.
Die Straße von Hormus als Realitätscheck
Die südkoreanische Regierung nennt als offiziellen Grund für die Absage die Lage im Nahen Osten – ein durchaus nachvollziehbares Argument. Für ein Land, das 72 Prozent seiner Rohölimporte über die Straße von Hormus bezieht, sind die jüngsten US-Angriffe auf den Iran keine abstrakte geopolitische Spielerei, sondern eine existenzielle Bedrohung der eigenen Energiesicherheit.
Hier zeigt sich die ganze Absurdität der westlichen Politik: Während man in Brüssel und Berlin von "wertebasierter Außenpolitik" schwadroniert, müssen andere Länder mit den realen Konsequenzen dieser abenteuerlichen Politik leben. Die südkoreanische Regierung arbeitet bereits im "Notfallmodus", um sich auf mögliche Unterbrechungen der Öllieferungen vorzubereiten.
Der Trump-Faktor und die neue Weltordnung
Donald Trumps Forderung nach einer Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf fünf Prozent des BIP zeigt, wohin die Reise geht. Die USA nutzen die NATO zunehmend als Instrument, um ihre Verbündeten finanziell auszupressen. Dass nun auch die asiatischen Partner diesem Druck ausgesetzt werden sollen, macht deutlich: Es geht nicht um gemeinsame Sicherheit, sondern um amerikanische Wirtschaftsinteressen.
Die Absage der asiatischen Staatschefs ist daher mehr als nur eine diplomatische Geste. Sie markiert möglicherweise den Beginn einer neuen Ära, in der sich Länder nicht mehr bedingungslos dem Diktat Washingtons unterwerfen. Während Deutschland und die EU weiterhin brav jeden Befehl aus Übersee befolgen, beginnen andere Nationen, ihre eigenen Wege zu gehen.
Ein Weckruf für Europa?
Die Entwicklung sollte auch für Europa ein Weckruf sein. Wenn selbst traditionelle US-Verbündete wie Japan, Südkorea und Australien beginnen, sich von der NATO zu distanzieren, sollte man in Berlin und Brüssel vielleicht einmal darüber nachdenken, ob der eingeschlagene Kurs wirklich im deutschen und europäischen Interesse liegt.
Stattdessen erleben wir eine Bundesregierung, die trotz aller Versprechungen von Friedrich Merz ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur plant und damit die Inflation weiter anheizt. Gleichzeitig verankert man die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz – ein ideologisches Projekt, das Generationen von Deutschen mit Schulden belastet, während andere Länder pragmatisch ihre nationalen Interessen verfolgen.
Die Abwesenheit der asiatischen Staatschefs beim NATO-Gipfel ist ein deutliches Zeichen: Die Welt ordnet sich neu, und nicht alle sind bereit, dem Westen in seinen selbstzerstörerischen Kurs zu folgen. Es wird Zeit, dass auch Deutschland wieder lernt, seine eigenen Interessen zu definieren und zu verteidigen – bevor es zu spät ist.
- Themen:
- #CDU-CSU
Papiervs.PhysischWarum echtes Metall jetzt alles entscheidet
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Jochen Staiger
Rohstoffexperte
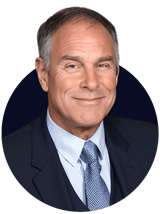
Rick Rule
Rohstoff-Legende
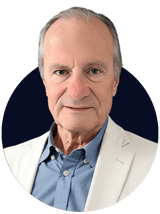
Alasdair Macleod
Chefstratege GoldMoney
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik