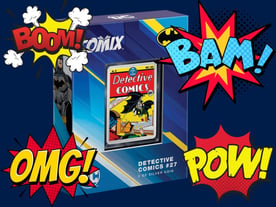Niederlande vor der Wahl: Wenn die politische Mitte plötzlich wieder attraktiv wird
Die Niederlande stehen vor einem bemerkenswerten politischen Wendepunkt. Während in weiten Teilen Europas die politischen Ränder erstarken und etablierte Parteien an Boden verlieren, deutet sich bei unseren westlichen Nachbarn eine überraschende Trendwende an. Am morgigen Mittwoch wählen die Niederländer ein neues Parlament – und könnten dabei ein Signal setzen, das auch für Deutschland von Bedeutung sein dürfte.
Das gescheiterte Experiment Schoof
Nach nicht einmal zwei Jahren ist das Kabinett des parteilosen Premierministers Dick Schoof spektakulär gescheitert. Was als Versuch begann, mit einem überparteilichen Technokraten die zerstrittene politische Landschaft zu befrieden, endete im völligen Desaster. Zwei der vier Koalitionspartner verließen das Regierungsbündnis, Neuwahlen wurden unausweichlich. Ein Lehrstück dafür, dass Politik ohne klare Führung und ideologische Grundlage zum Scheitern verurteilt ist.
Besonders pikant: Der ehemalige Geheimdienst-Offizier Schoof genoss durchaus respektable Beliebtheitswerte in der Bevölkerung. Doch was nützt persönliche Integrität, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht stimmen? Er wird nun als Übergangs-Regierungschef die Geschäfte führen, bis sich eine neue Koalition gefunden hat – ein würdeloser Abgang für einen Mann, der eigentlich bis 2028 regieren sollte.
Wilders' Pyrrhussieg: Wenn Maximalpositionen nach hinten losgehen
Die eigentliche Sensation zeichnet sich jedoch in den Umfragen ab. Geert Wilders, der Anführer der rechten Partei für die Freiheit (PVV), muss mit herben Verlusten rechnen. Von einst stolzen 33 Prozent im Frühjahr 2024 sehen ihn Meinungsforscher nur noch bei mageren 19 Prozent. Ein Absturz, der seinesgleichen sucht.
Was war geschehen? Wilders hatte im Juni die Regierungskoalition verlassen, weil seine Partner nicht bereit waren, das „strengste Asylsystem in der Geschichte der Niederlande" mitzutragen. Der Staatsrat, ein wichtiges juristisches Beratungsgremium, hatte Teile seines radikalen Konzepts als unpraktikabel verworfen. Anstatt Kompromisse zu suchen, ließ Wilders das Regierungsbündnis platzen – ein fataler Fehler, wie sich nun zeigt.
Ein Déjà-vu mit bitterem Beigeschmack
Geschichte wiederholt sich offenbar doch. Schon 2012 hatte Wilders das Kabinett Rutte I in einer Rentendebatte gesprengt und dabei auf Neuwahlen spekuliert. Damals wie heute rechnete er damit, dass seine Themen den Wahlkampf dominieren würden. Doch die Wähler honorierten seine Destruktivität nicht mit Zustimmung, sondern mit Ablehnung. Die meisten übrigen politischen Kräfte schlossen eine künftige Zusammenarbeit mit der PVV kategorisch aus.
Die überraschende Renaissance der Mitte
Während Wilders abstürzt, erleben die Christdemokraten (CDA) eine bemerkenswerte Wiederauferstehung. Von katastrophalen 3 Prozent vor zwei Jahren haben sie sich auf beachtliche 15 Prozent hochgearbeitet. Henri Bontenbal könnte sogar Ansprüche auf das Amt des Regierungschefs erheben, sollte seine Partei die Sozialdemokraten überholen.
Als leichter Favorit auf das Premierministeramt gilt jedoch der Sozialdemokrat Frans Timmermans mit seinem rot-grünen Bündnis. Mit prognostizierten 16 Prozent liegt er zwar nur knapp vor der Konkurrenz, doch seine Chancen auf eine Regierungsbildung stehen nicht schlecht – vorausgesetzt, er landet auf dem zweiten Platz hinter Wilders.
Gewinner und Verlierer im politischen Karussell
Die linksliberalen Democraten'66 hoffen mit Rob Jetten auf einen Überraschungserfolg. Mit 12 Prozent könnten sie ihr Ergebnis von 2023 mehr als verdoppeln. Die rechtsliberale VVD muss hingegen mit Verlusten rechnen, könnte aber für eine Koalitionsbildung unverzichtbar werden. Der Neue Gesellschaftsvertrag (NSC), vor zwei Jahren noch als Hoffnungsträger gefeiert, steht vor dem völligen Zerfall – ein Lehrstück über die Vergänglichkeit politischer Hypes.
Themen jenseits der Asylpolitik dominieren
Bemerkenswert ist die thematische Verschiebung im Wahlkampf. Zwar spielt das Asylthema für 36 Prozent der Wähler noch eine wichtige Rolle, doch andere Sorgen dominieren mittlerweile die öffentliche Debatte. Die explodierenden Wohnkosten und der knappe Immobilienmarkt bereiten den Niederländern größere Kopfschmerzen als die Zuwanderungsfrage.
Wirtschaftsflaute, Inflation, hohe Steuern und die marode Gesundheitsversorgung – das sind die Themen, die die Menschen wirklich bewegen. Während Parteien wie VVD und PVV auf Einsparungen setzen, versprechen die Sozialdemokraten Problemlösungen durch öffentliche Investitionen. Ein klassischer Links-Rechts-Konflikt, der zeigt: Die Niederlande kehren zur politischen Normalität zurück.
Lehren für Deutschland
Was können wir in Deutschland aus dieser Entwicklung lernen? Die niederländische Erfahrung zeigt eindrucksvoll, dass populistische Maximalforderungen und destruktive Politik auf Dauer nicht honoriert werden. Wähler mögen klare Positionen, aber sie schätzen auch Kompromissfähigkeit und konstruktive Lösungen.
Während hierzulande die Ampel-Koalition zerbrochen ist und die neue Große Koalition unter Friedrich Merz bereits mit einem 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur plant – trotz gegenteiliger Wahlversprechen –, zeigen die Niederlande, dass es auch anders geht. Die Rückbesinnung auf die politische Mitte könnte ein Modell sein, das auch für Deutschland Relevanz hat.
Eines ist sicher: Die morgige Wahl in den Niederlanden wird nicht nur für unsere Nachbarn richtungsweisend sein. Sie könnte ein Signal für ganz Europa setzen – ein Signal, dass die Zeit der politischen Extreme möglicherweise ihren Zenit überschritten hat. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, wird sich zeigen. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung, und das ist in diesen turbulenten Zeiten vielleicht die beste Nachricht überhaupt.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik