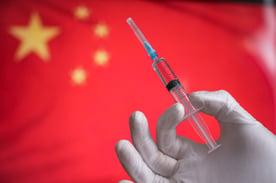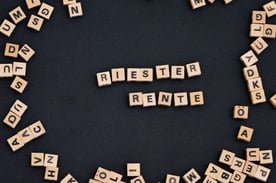
Trumps Zoll-Deal mit der EU: Ein fauler Kompromiss auf Kosten deutscher Arbeitsplätze
Was für ein Schauspiel in Schottland! Während Donald Trump seinen angeblich "größten Deal jemals" feiert, applaudieren die EU-Vertreter brav mit – und verkaufen dabei die Interessen der europäischen Wirtschaft. Die Einigung im transatlantischen Zollstreit mag auf den ersten Blick wie ein diplomatischer Erfolg aussehen. Doch wer genauer hinschaut, erkennt schnell: Europa hat sich über den Tisch ziehen lassen.
Der Preis des "Friedens": 15 Prozent Dauerschmerz
Statt der angedrohten 30 Prozent Zölle müssen europäische Unternehmen nun "nur" 15 Prozent Basiszoll auf ihre Exporte in die USA zahlen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkauft das als Erfolg. Doch die Wahrheit ist bitter: Vor Trumps Amtsantritt lag der durchschnittliche US-Zollsatz auf EU-Importe bei gerade einmal einem Prozent. Wir reden hier also von einer Verfünfzehnfachung der Handelsbarrieren – und das soll ein Grund zum Feiern sein?
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) bringt es auf den Punkt: Dies sei ein "fatales Signal" und ein "unzureichender Kompromiss". Selbst die 15 Prozent würden immense negative Auswirkungen haben. Besonders die deutsche Automobilindustrie, ohnehin schon durch die verfehlte Klimapolitik der vergangenen Jahre gebeutelt, wird diese Zusatzbelastung zu spüren bekommen.
Merkels Erbe: Eine EU ohne Rückgrat
Wie konnte es soweit kommen? Die Antwort liegt in der systematischen Schwächung Europas durch jahrzehntelange Fehlentscheidungen. Während man sich in Brüssel und Berlin mit Gender-Sternchen und Klimaneutralität beschäftigte, vernachlässigte man sträflich die harten Realitäten der Geopolitik. Die militärische Abhängigkeit von den USA ist das Ergebnis einer naiven Politik, die glaubte, man könne sich in einer zunehmend gefährlichen Welt auf "soft power" verlassen.
"Wären die Europäer im Bereich der Verteidigung nicht so abhängig von den USA, hätten sie den Deal vielleicht nicht akzeptiert."
Diese Einschätzung aus EU-Kreisen offenbart die ganze Misere. Trump konnte seine Zollkeule schwingen, weil er wusste: Europa kann es sich nicht leisten, die transatlantische Partnerschaft aufs Spiel zu setzen. Nicht mit Russland vor der Haustür und einer Bundeswehr, die nach Jahren der Vernachlässigung kaum verteidigungsfähig ist.
Die wahren Gewinner und Verlierer
Während Trump Milliarden an zusätzlichen Zolleinnahmen in die US-Staatskasse spülen wird, zahlen europäische Unternehmen und letztlich die Verbraucher die Zeche. Die EU verpflichtet sich zudem, Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen und weitere 600 Milliarden in den USA zu investieren. Das sind astronomische Summen, die der europäischen Wirtschaft entzogen werden.
Besonders pikant: Bei Stahl und Aluminium bleibt der Zollsatz sogar bei satten 50 Prozent. Für eine Industrienation wie Deutschland, die auf den Export hochwertiger Metallprodukte angewiesen ist, ist das ein Schlag ins Gesicht.
Merz' Kniefall vor Washington
Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt die Einigung und dankt brav der EU-Kommission. Doch wo bleibt der Aufschrei? Wo ist der Widerstand gegen diese Erpressung? Stattdessen hören wir die üblichen Floskeln von "transatlantischer Partnerschaft" und "Vermeidung einer Eskalation".
Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) zeigt sich ebenfalls "zufrieden" – ein Armutszeugnis für eine Regierung, die eigentlich deutsche Interessen vertreten sollte. Seine Aussage, man müsse sich "unabhängiger aufstellen", kommt Jahre zu spät und klingt angesichts der aktuellen Kapitulation wie blanker Hohn.
Zeit für einen Kurswechsel
Diese Einigung zeigt einmal mehr: Deutschland und Europa brauchen dringend eine neue strategische Ausrichtung. Statt sich in ideologischen Grabenkämpfen zu verlieren, müssen wir endlich wieder realpolitisch denken und handeln. Das bedeutet:
Erstens: Massive Investitionen in die eigene Verteidigungsfähigkeit, um nie wieder erpressbar zu sein. Die 500 Milliarden Euro Sondervermögen, die Merz für Infrastruktur plant, wären in der Bundeswehr besser angelegt.
Zweitens: Eine Industriepolitik, die unsere Schlüsselbranchen stärkt statt schwächt. Die Automobilindustrie braucht Unterstützung, keine weiteren Klimaauflagen.
Drittens: Diversifizierung der Handelsbeziehungen. Wer sich zu abhängig von einem Partner macht, wird erpressbar – das gilt für China genauso wie für die USA.
Gold als Anker in stürmischen Zeiten
In Zeiten wie diesen, in denen Handelskriege die Weltwirtschaft erschüttern und Politiker versagen, gewinnen physische Werte an Bedeutung. Während Aktienmärkte durch Zollstreitigkeiten ins Wanken geraten und Währungen durch politische Unsicherheiten unter Druck kommen, bleibt Gold ein stabiler Anker. Es ist kein Zufall, dass kluge Anleger in Krisenzeiten verstärkt auf Edelmetalle setzen – sie sind der ultimative Schutz vor den Folgen politischer Fehlentscheidungen.
Die Einigung zwischen Trump und der EU mag kurzfristig Erleichterung bringen. Doch sie ist nur ein Symptom einer viel größeren Krise: Europa hat seine Souveränität und Verhandlungsmacht weitgehend eingebüßt. Es wird Zeit, dass wir uns das eingestehen und die richtigen Konsequenzen ziehen. Sonst werden wir beim nächsten "größten Deal jemals" noch schlechter dastehen.

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik