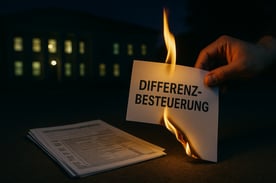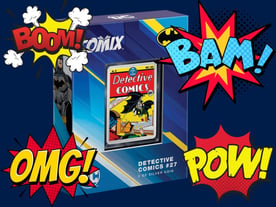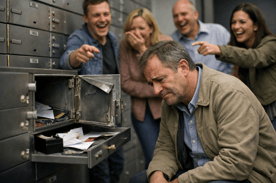Wenn Drogenkartelle nach politischer Macht greifen: Kolumbiens gefährlicher Tanz mit dem organisierten Verbrechen
Es klingt wie ein schlechter Scherz, doch die Realität in Kolumbien übertrifft jede Satire: Das mächtigste Drogenkartell des Landes, der berüchtigte Clan del Golfo, möchte als politische Organisation anerkannt werden. Während in Deutschland die Regierung mit Gender-Sternchen und Klimaneutralität beschäftigt ist, verhandelt der kolumbianische Präsident Gustavo Petro – selbst ein ehemaliger Guerillero – mit den größten Kokain-Produzenten der Welt über deren politische Legitimierung.
Der Wahnsinn hat Methode
Die Gespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und dem Clan del Golfo fänden außerhalb des Landes statt, verkündete Präsident Petro bei einem Besuch in Córdoba. Details zum Ort und Inhalt der Verhandlungen? Fehlanzeige. Man stelle sich vor, die deutsche Bundesregierung würde mit der organisierten Kriminalität über deren Anerkennung als politische Kraft verhandeln – der Aufschrei wäre groß. Doch in Kolumbien scheint dies zur neuen Normalität zu gehören.
Das Kartell, das aus früheren paramilitärischen Verbänden hervorgegangen sei und über 7.500 Mitglieder verfüge, strebe nach juristischen Begünstigungen, wie sie entwaffnete Guerilleros und Paramilitärs genießen würden. Im Klartext: Massenmörder und Drogenbarone wollen Straffreiheit für ihre Verbrechen. Die US-Regierung habe den Clan del Golfo nicht umsonst im Februar auf die Liste terroristischer Organisationen gesetzt.
Ein gefährlicher Präzedenzfall
Besonders brisant: Im Juli habe Petros Regierung einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der kriminellen Banden im Gegenzug für ihre Selbstentwaffnung Straferlasse und Schutz vor Auslieferung in die USA verspreche. Man fragt sich unwillkürlich, ob der linksgerichtete Präsident vergessen hat, dass er nicht mehr auf Seiten der Guerilla, sondern auf Seiten des Rechtsstaats stehen sollte.
Gewalt als politisches Mittel
Wie ernst die Lage ist, zeige der Fall des konservativen Präsidentschaftskandidaten Miguel Uribe. Der entschiedene Kritiker von Petros Politik und Gegner der Drogenkartelle kämpfe nach einem Attentat im Juni um sein Leben. Die behandelnden Ärzte hätten mitgeteilt, dass sich sein Zustand lebensbedrohlich verschlechtert habe. Eine Hirnblutung mache neurochirurgische Eingriffe erforderlich.
Bei dem mutmaßlichen Schützen handle es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen – ein Kind als Auftragskiller. Die Behörden gingen davon aus, dass Ex-Mitglieder der aufgelösten Guerilla-Organisation FARC hinter dem Anschlag steckten. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden.
Die Spirale der Gewalt dreht sich weiter
Viele Kolumbianer fürchteten eine Rückkehr zu den blutigen 80er und 90er Jahren, als Anschläge der Drogenkartelle und politische Morde zum Alltag gehörten. Diese Befürchtungen scheinen sich zu bewahrheiten. Trotz des Friedensabkommens mit der FARC von 2016 habe sich die Sicherheitslage nicht nachhaltig verbessert.
Ironischerweise sei Uribe selbst am 1. August zu 12 Jahren Hausarrest verurteilt worden – wegen versuchter Bestechung von Zeugen in einer Untersuchung zu seinen angeblichen Verbindungen zu Paramilitärs. Seine Anwälte hätten Berufung eingelegt. Man könnte meinen, in Kolumbien seien die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht, vollständig verschwommen.
Lehren für Deutschland
Was können wir aus dieser besorgniserregenden Entwicklung lernen? Wenn der Rechtsstaat erst einmal anfängt, mit Verbrechern zu verhandeln statt sie konsequent zu verfolgen, ist der Weg in die Anarchie nicht mehr weit. In Deutschland erleben wir bereits eine beunruhigende Zunahme der Kriminalität, insbesondere durch Messerangriffe. Die Politik reagiert darauf mit Beschwichtigungen und Relativierungen statt mit konsequentem Durchgreifen.
Die kolumbianische Tragödie sollte uns eine Warnung sein: Wer mit dem organisierten Verbrechen paktiert, wird am Ende selbst zum Opfer. Ein starker Rechtsstaat, der seine Bürger schützt, lässt sich nicht auf Verhandlungen mit Kriminellen ein. Er setzt das Recht durch – ohne Wenn und Aber.
In Zeiten wie diesen, in denen traditionelle Werte und Sicherheit immer mehr unter Druck geraten, wird die Bedeutung von stabilen Werten deutlich. Während Regierungen weltweit fragwürdige Entscheidungen treffen, suchen kluge Anleger nach verlässlichen Alternativen zur Vermögenssicherung. Physische Edelmetalle haben sich über Jahrhunderte als krisenfeste Anlage bewährt und bieten gerade in unsicheren Zeiten eine sinnvolle Ergänzung für ein ausgewogenes Portfolio.
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik