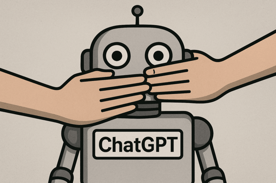Chinas E-Auto-Wahn: Wenn der Traum vom Weltmarktführer zum wirtschaftlichen Albtraum wird
Die chinesische Autoindustrie gleicht einem Patienten auf der Intensivstation: Die Überproduktion hat lebensbedrohliche Ausmaße angenommen, während die Nachfrage kollabiert. Was einst als Masterplan zur Eroberung der Weltmärkte gedacht war, entpuppt sich nun als wirtschaftspolitisches Desaster erster Güte. Neuwagen werden zu Ramschpreisen verschleudert, Autofriedhöfe wachsen ins Unermessliche, und die Hersteller produzieren stur weiter – als gäbe es kein Morgen.
Ausverkauf im Reich der Mitte: Wenn Neuwagen zu Ladenhütern werden
In Chengdu offenbart sich das ganze Elend: Ein nagelneuer Audi für die Hälfte des Listenpreises? Ein siebensitziges SUV mit über 60 Prozent Rabatt? Was nach einem schlechten Scherz klingt, ist bittere Realität. Wang Lihong, der für den Händler Zcar arbeitet, filmt diese automobilen Schnäppchen für Social Media – und trifft dabei den Nagel auf den Kopf: "Es gibt kein Auto, das nicht verkauft werden kann, es gibt nur einen Preis, der nicht passt."
Diese Worte könnten als Epitaph für Chinas gescheiterte Industriepolitik dienen. Denn was hier passiert, ist nichts anderes als die Kapitulation vor den eigenen Ambitionen. Händler geben Fahrzeuge lieber als Tageszulassungen in den Graumarkt, als sie in ihren Hallen verstauben zu lassen. Ein System, das an Absurdität kaum zu überbieten ist.
Der verhängnisvolle Masterplan aus Peking
Die Wurzeln dieses Debakels reichen tief. Bereits in den 1990er Jahren träumten Chinas Politiker davon, mit Elektroautos die Weltmärkte zu erobern. 2009 folgte das erste Milliardenprogramm, 2017 dann der entscheidende Schachzug: Der "Mittel- und langfristige Entwicklungsplan für die Autoindustrie" sollte die Produktion bis 2025 auf 35 Millionen Fahrzeuge jährlich hochschrauben.
Was folgte, war ein Rausch der Superlative. Provinzverwaltungen lockten Autobauer mit billigem Land, Steuergeschenken und dem Versprechen auf Arbeitsplätze. Die Gemeinde Changfeng etwa bot BYD Baugrund 40 Prozent unter Marktpreis an. Das Ergebnis? Ein modernes E-Auto-Werk in einer Region, die zuvor hauptsächlich für ihr traditionelles Fladenbrot bekannt war.
Wenn Politik auf Marktwirtschaft trifft – und verliert
Chen Keyun, ein Autohändler im Ruhestand, bringt es auf den Punkt: Das chinesische Wirtschaftsmodell sei vollständig auf Produktion ausgerichtet, nicht auf Nachfrage. Eine Erkenntnis, die so simpel wie vernichtend ist. Während im Westen die unsichtbare Hand des Marktes regiert, dirigiert in China die sehr sichtbare Hand der Partei – mit katastrophalen Folgen.
Die Kommunen machen den Autobauern sogar konkrete Produktionsvorgaben. Guangzhou etwa will drei Hersteller fördern, die jeweils 500.000 Elektroautos jährlich produzieren sollen. Wer binnen drei Jahren eine Fabrik für mindestens 100.000 Autos baut, erhält jährlich umgerechnet 60 Millionen Euro. Ein Irrsinn, der seinesgleichen sucht.
Der Teufelskreis der Überproduktion
Seit drei Jahren tobt nun ein gnadenloser Preiskrieg. Selbst Präsident Xi Jinping musste im Sommer eingestehen, dass die Situation unhaltbar sei. Doch statt die Notbremse zu ziehen, strampeln die Hersteller weiter – wie Liang Linhe vom Lkw-Bauer Sany Heavy Truck treffend bemerkt: "Es ist wie beim Fahrradfahren: Solange man strampelt, ist man zwar vielleicht außer Atem, aber fällt nicht um."
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 2024 liefen 31 Millionen Autos vom Band, doch die Kapazitäten sind weitaus höher. Was nicht verkauft wird, landet auf Autofriedhöfen oder wird bei Alibaba versteigert. Allein in diesem Jahr wurden dort über 5.100 BYD-Fahrzeuge unter den Hammer gebracht – im Vorjahr waren es gerade einmal 61.
Das große Sterben steht bevor
He Xiaopeng, Chef des Volkswagen-Partners Xpeng, prophezeit, dass von den derzeit 129 E-Auto- und Hybridmarken nur acht als eigenständige Unternehmen überleben werden. Die Beratungsgesellschaft Alix Partners ist noch pessimistischer: Nur 15 Marken dürften es bis 2030 schaffen.
Die marktwirtschaftliche Lösung wäre simpel: Die Schwachen sterben lassen. Doch Chinas Politiker fürchten Massenarbeitslosigkeit und sozialen Unfrieden. Also hält man die Zombieunternehmen künstlich am Leben – ein Spiel auf Zeit, das niemand gewinnen kann.
Lehren für Deutschland: Wenn Planwirtschaft auf Realität trifft
Was können wir aus diesem Desaster lernen? Zunächst einmal zeigt es eindrucksvoll, wohin staatliche Überregulierung und Planwirtschaft führen. Während unsere Ampelregierung mit ähnlich ambitionierten Klimazielen und Subventionsprogrammen hantierte, sollte Chinas Scheitern als mahnendes Beispiel dienen.
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz täte gut daran, diese Lektion zu beherzigen. Statt mit 500-Milliarden-Sondervermögen die nächste Subventionsblase zu schaffen, sollte man auf die Kräfte des freien Marktes vertrauen. Denn eines zeigt China überdeutlich: Wer gegen den Markt regiert, regiert ins Chaos.
In einer Zeit, in der physische Werte wieder an Bedeutung gewinnen, erscheint die Investition in greifbare Vermögenswerte wie Edelmetalle als sinnvolle Alternative zu den Luftschlössern staatlich geförderter Überproduktion. Gold und Silber mögen keine spektakulären Renditen versprechen, aber sie verschwinden auch nicht auf Autofriedhöfen oder in Versteigerungsportalen.
- Themen:
- #Gold
- #Silber
- #Übernahmen-Fussion
Silber-Explosion 2026:Das unterschätzte Edelmetall
Keine Kreditkarte erforderlich • Keine versteckten Kosten
Ihre Experten im Webinar:

Dominik Kettner
CEO Kettner Edelmetalle

Ernst Wolff
Der Systemkritiker

Jochen Staiger
Der Rohstoff-Realist
Top-Experten
Dominik Kettner & Star-Gäste
Live Q&A
Ihre Fragen
15.000€ Gold
zu gewinnen
- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik