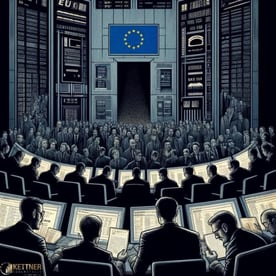EU-Kommission knöpft sich chinesischen Billig-Giganten Temu vor: Verbraucherschutz oder Protektionismus?
Die Brüsseler Regulierungsmaschinerie läuft wieder auf Hochtouren. Diesmal im Visier: Der chinesische Online-Marktplatz Temu, dem die EU-Kommission schwerwiegende Verstöße gegen das Gesetz über digitale Dienste (DSA) vorwirft. Doch während die EU-Bürokraten von Verbraucherschutz sprechen, drängt sich die Frage auf: Geht es hier wirklich um die Sicherheit europäischer Konsumenten oder vielmehr um den Schutz heimischer Märkte vor unliebsamer Konkurrenz aus Fernost?
Gefährliches Spielzeug oder gefährliche Konkurrenz?
Die Vorwürfe wiegen schwer: Temu habe es versäumt, die Risiken illegaler Produkte auf seiner Plattform angemessen zu bewerten. Ein sogenanntes "Mystery-Shopping-Verfahren" der Kommission habe ergeben, dass Verbraucher "sehr wahrscheinlich" auf nicht konforme Produkte stoßen würden - insbesondere bei Babyspielzeug und kleinen Elektronikartikeln. Die Risikobewertung des Unternehmens vom Oktober 2024 sei ungenau gewesen und habe sich auf allgemeine Brancheninformationen gestützt, anstatt die spezifischen Gegebenheiten des eigenen Marktplatzes zu berücksichtigen.
EU-Kommissionsvize Henna Virkkunen tönte vollmundig: "Die Sicherheit der Verbraucher im Internet ist in der EU nicht verhandelbar." Ein hehres Ziel, zweifellos. Doch warum konzentriert sich die Kommission ausgerechnet auf einen chinesischen Anbieter, während europäische Online-Marktplätze offenbar weniger streng unter die Lupe genommen werden?
Milliardenstrafen als Drohkulisse
Die möglichen Konsequenzen für Temu sind drakonisch: Sollte die Kommission bei ihrer vorläufigen Einschätzung bleiben, drohen Geldbußen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Bei einem Unternehmen der Größenordnung von Temu sprechen wir hier von Summen, die schnell in die Milliarden gehen könnten. Ein Schelm, wer dabei an die leeren Staatskassen und die explodierenden Schulden der EU-Mitgliedsstaaten denkt.
Besonders pikant: Während die EU-Kommission mit der einen Hand chinesische Unternehmen abstrafen möchte, predigt sie mit der anderen Hand den freien Welthandel. Diese Doppelmoral ist symptomatisch für eine Politik, die zunehmend protektionistische Züge annimmt, während sie gleichzeitig von offenen Märkten schwadroniert.
Der größere Kontext: Handelskrieg durch die Hintertür?
Die Aktion gegen Temu fügt sich nahtlos in ein größeres Muster ein. Seit Donald Trump mit seinen massiven Zollerhöhungen - 20 Prozent auf EU-Importe, satte 34 Prozent auf chinesische Waren - Ernst macht, sucht auch die EU nach Wegen, ihre Märkte zu schützen. Doch anstatt ehrlich zu sein und offen protektionistische Maßnahmen zu ergreifen, versteckt man sich hinter vermeintlichen Verbraucherschutzargumenten.
Dabei ist die Realität eine andere: Millionen europäischer Verbraucher nutzen Plattformen wie Temu, weil sie dort Produkte zu Preisen finden, die ihnen der heimische Handel nicht bieten kann oder will. In Zeiten galoppierender Inflation und sinkender Reallöhne - nicht zuletzt dank der verfehlten Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre - sind günstige Alternativen für viele Bürger schlicht eine Notwendigkeit geworden.
Verbraucherschutz ja, aber mit Augenmaß
Natürlich müssen Produkte, die auf dem europäischen Markt verkauft werden, sicher sein. Niemand möchte, dass Kinder mit gefährlichem Spielzeug in Kontakt kommen. Doch die Frage bleibt: Warum werden chinesische Anbieter mit einer Intensität verfolgt, die bei heimischen Unternehmen selten zu beobachten ist? Und warum konzentriert sich die EU-Kommission auf Symptome, anstatt die Ursachen anzugehen - etwa die Tatsache, dass viele Verbraucher auf günstige Alternativen angewiesen sind, weil die Politik sie mit immer höheren Steuern und Abgaben belastet?
Die neue Große Koalition unter Friedrich Merz hat ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Infrastruktur aufgelegt - trotz des Versprechens, keine neuen Schulden zu machen. Diese Schuldenlast wird Generationen belasten und die Inflation weiter anheizen. Gleichzeitig wird die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert, was weitere Milliardenkosten nach sich ziehen wird. In diesem Kontext erscheint die Jagd auf ausländische Online-Händler wie ein Ablenkungsmanöver von den eigenen Versäumnissen.
Die EU täte gut daran, sich auf echten Verbraucherschutz zu konzentrieren, anstatt unter diesem Deckmantel Handelskriege zu führen. Denn am Ende zahlen die Verbraucher die Zeche - durch höhere Preise, weniger Auswahl und eine Politik, die ihre wahren Interessen aus den Augen verloren hat.
- Themen:
- #Steuern

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik