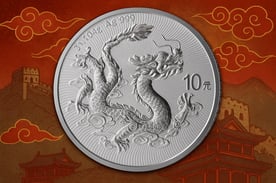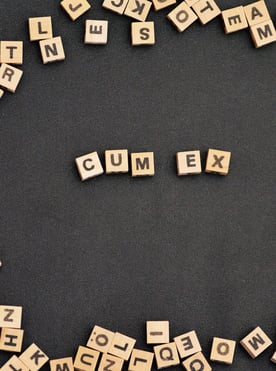Verfassungsgericht zieht Staatstrojanern die Zähne – Ein überfälliger Schritt für den Rechtsstaat
Das Bundesverfassungsgericht hat endlich getan, was längst überfällig war: Den ausufernden Überwachungsfantasien unserer Sicherheitsbehörden einen Riegel vorgeschoben. Die Karlsruher Richter erklärten wesentliche Teile der seit 2017 geltenden Regelungen zu Staatstrojanern für verfassungswidrig. Ein Paukenschlag, der zeigt, wie weit sich unser Rechtsstaat bereits von seinen Grundprinzipien entfernt hatte.
Die digitale Hintertür wird zugeschlagen
Besonders brisant: Die sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberwachung bei Straftaten mit einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren wurde für nichtig erklärt – und das sogar rückwirkend. Man stelle sich vor: Jahrelang haben Ermittler auf Basis verfassungswidriger Gesetze in die intimsten Bereiche der Privatsphäre eingegriffen. WhatsApp-Nachrichten mitgelesen, Telegram-Chats überwacht, Computer durchforstet – alles im Namen der Sicherheit, aber offenbar ohne ausreichende rechtsstaatliche Grundlage.
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts machte unmissverständlich klar: Solche massiven Grundrechtseingriffe dürfen nicht bei jedem Kleinkriminellen zum Einsatz kommen. Die Verhältnismäßigkeit müsse gewahrt bleiben, betonten die Richter. Ein Prinzip, das in Zeiten hysterischer Sicherheitsdebatten offenbar in Vergessenheit geraten war.
Sicherheitslücken als Einfallstor für alle
Was die Befürworter dieser digitalen Überwachungsinstrumente gerne verschweigen: Staatstrojaner funktionieren nur, wenn Sicherheitslücken in unseren Geräten bestehen bleiben. Der Verein Digitalcourage brachte es auf den Punkt: Diese Hintertüren stehen nicht nur der Polizei offen, sondern auch Kriminellen, ausländischen Geheimdiensten und anderen zwielichtigen Akteuren. Der Staat, der eigentlich seine Bürger schützen sollte, macht sie verwundbarer – ein Paradoxon, das nun endlich höchstrichterlich gewürdigt wurde.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 104 richterliche Anordnungen zur Quellen-TKÜ gab es allein 2023, tatsächlich durchgeführt wurden 62. Bei den noch invasiveren Online-Durchsuchungen waren es 26 Anordnungen und sechs Durchführungen. Meist ging es dabei um den Vorwurf der Bildung krimineller Vereinigungen – ein dehnbarer Begriff, der in der Vergangenheit schon oft zur Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen herhalten musste.
Ein Sieg für die Bürgerrechte – vorerst
Doch Vorsicht ist geboten: Das Gericht erklärte die Online-Durchsuchung nur in Teilen für verfassungswidrig und erlaubt deren Fortführung bis zu einer Neuregelung. Man darf gespannt sein, welche kreativen Umgehungsversuche die neue Große Koalition unter Friedrich Merz unternehmen wird. Die CDU/CSU war schließlich schon immer ein glühender Verfechter ausgeweiteter Sicherheitsbefugnisse.
Es bleibt zu hoffen, dass dieses Urteil ein Weckruf für all jene ist, die in ihrer Sicherheitshysterie vergessen haben, dass ein freiheitlicher Rechtsstaat nicht trotz, sondern wegen seiner Beschränkungen staatlicher Macht funktioniert. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit muss gewahrt bleiben – auch und gerade im digitalen Zeitalter.
"Ausgehend von dem sehr hohen Eingriffsgewicht muss die Quellen-Telekommunikationsüberwachung aus Gründen der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne auf die Verfolgung besonders schwerer Straftaten beschränkt sein."
Diese klaren Worte des Bundesverfassungsgerichts sollten allen Sicherheitspolitikern ins Stammbuch geschrieben werden. In Zeiten, in denen die Kriminalität tatsächlich zunimmt – nicht zuletzt durch die verfehlte Migrationspolitik der vergangenen Jahre – ist die Versuchung groß, mit immer schärferen Überwachungsmaßnahmen zu reagieren. Doch der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ein Rechtsstaat, der seine eigenen Prinzipien über Bord wirft, hat bereits verloren.
- Themen:
- #CDU-CSU

- Kettner Edelmetalle News
- Finanzen
- Wirtschaft
- Politik